Wenn sanft die Spinne aus der Wange krabbelt
Moderne Sagen als Ventil für die Unwägbarkeiten des Lebens
Am Biertisch wird es still in der Runde. Ein junger Mann erzählt von der
Bekannten eines Bekannten, die mit einer Gruppe von Aussteigern nach Indien gefahren war.
"Also, die gehörte zu diesen alternativen Kreisen, kam aus Indien zurück, hatte
fürchterliche Schmerzen in der Wange - und die war unheimlich dick und heiß und rot
geschwollen, und nach einigen Tagen hier zu Hause, da ist das dann irgendwie aufgeplatzt,
und es kamen ganz viele Spinnen da 'raus."
Igittegitt. Jeder in der Runde schüttelt sich vor Ekel. Ein blondes
Mädchen erschauert kurz und berichtet dann von einer ähnlichen Begebenheit - von einer
Mutter, die ihrem Kind die geschwollene Backe abtupft. "Und auf einmal platzt das
auf, und da kommen dann die Spinnen 'raus." Mutter wie Indienreisende kamen angeblich
mit schwerem Schock ins Krankenhaus.

Blödsinn! Denkt der aufgeklärte Skeptiker von heute. Niemand würde so
etwas glauben! Er irrt! In diesen modernen Zeiten kursieren unendlich viele unglaubliche
Geschichten. Sagen von heute. Der Alltag steckt voller Bedrohungen, Gefahren und
Geheimnisse, konfrontiert mit unheimlichen Menschen, fremdländischen Sitten, unbekannten
Tieren, Krankheiten und den Tücken der Hochtechnisierung. Die Massenmedien oder auch das
Internet rücken eine immer weitere Welt in immer größere Nähe - und beflügeln damit
auch die Fantasie. Unverändert teilen Menschen einander mit, was sie erlebt haben, wenn
es auch nicht immer die ganze Wahrheit ist: Sie schönen und verbrämen, übertreiben und
flunkern, lassen weg und dichten hinzu. Spiegelbild einer Volkskultur, die in kurzen
Augenblicken lebt.
Der Germanist und Erzählforscher Helmut Fischer aus Hennef/Sieg hat
solche Augenblicke festgehalten. Zwischen 1975 und 1990 hat er in Stadt und Land an Rhein
und Ruhr dem Volk aufs Maul geschaut, sprich: den Kassettenrekorder in Wohnzimmern,
Partykellern, Kneipen, Wartezimmern und Büros mitlaufen lassen. Dem "gelegentlich
lästigen Gast" gelang eine außergewöhnliche Sammlung alltäglichen Erzählgutes.
Fischer schrieb die Geschichten auf, wie sie formuliert worden waren, und hat damit ein
wertvolles Dokument moderner Alltagskultur geschaffen. Hinter dem Titel "Der
Rattenhund - Sagen der Gegenwart" verbergen sich haarsträubende, gruselige,
tragische und witzige Begebenheiten; einige davon hat jeder von uns mit Sicherheit schon
einmal irgendwo gehört. Fischers Forschung hat mit dem Klischee aufgeräumt, dass die
Fabulierer und Geschichtenerzähler ausgestorben seien, weil der Mensch von heute in einer
passiven Konsumentenrolle erstarrt. Nein! Wir sind nicht stumm geworden.
Wie Erzählungen und Medien korrelieren, zeigt eine Begebenheit, die 1982
in Essen erzählt wurde und vorher lange durch den Medienwald gerauscht war: Der
unsichtbare "Chopper" hatte ahnungslose Patienten eines Regensburger Zahnarztes
aus dem Spuckbecken angepöbelt. Ein erklärbarer, inszenierter Spaß, wie sich später
herausstellte. Einer hat's erlebt und weitererzählt, ein Reporter bekam Wind davon, dann
stand es in der Zeitung. So ähnlich mag es auch mit der "Schwarzen Frau"
gewesen sein, die zwischen Rosenheim und Salzburg ihr Unwesen trieb, ganze Dörfer
verunsicherte und durch Polizeiprotokolle und Medien geisterte. Sie wurde von Autofahrern
mitgenommen, prophezeihte einen "blutigen Herbst", gab sich als der Erzengel
Gabriel aus, war gelegentlich auch ein Mann oder verhinderte durch Vorwarnung tödliche
Unfälle. Um Unfallopfer, die aus dem Jenseits erscheinen und als Schutzengel Autofahrer
vor Unglück bewahren, ranken sich unzählige Versionen, "Geschichten vom
verschwundenen Anhalter". Hier wird das Merkmal der Sage deutlich: Unausgesprochen
verbindet sich mit der Erscheinung die Warnung vor der Gefährlichkeit des Autofahrens.
Der Mensch findet sich im High-Tech-Alltag nicht zurecht und meistert Bedrohung und
Gefahr, indem er sie verdrängt. Wie könnten die Menschen sich seelenruhig ans Steuer
ihrer Autos setzen, wenn der Verstand ihnen unablässig zufunkte, dass sie damit ein
Mordinstrument in der Hand haben? Sie gehen also davon aus, dass nichts passieren wird.
Geschichten wie die von der Wiedergängerin in Schwarz oder neuerdings auch wieder von
Hexen, die angeblich bewirken, dass einer sich zu Tode fährt, wirken wie ein Ventil für
die Unwägbarkeiten des Lebens.
Zur Angst vor dem Tod gehört auch die Angst vor Vergiftungen. Eine
Geschichte dazu: Eine Familie lädt eine ganze Reihe von Gästen zum Abendessen ein. Der
Clou des Dinners soll ein großer Lachs sein, den die Hausfrau kauft und anrichtet. Sie
deckt den Tisch, stellt die Platte mit dem Lachs darauf und sieht nach einer Weile, dass
ihre Katze von dem Lachs nascht. Großes Hallo, die Katze wird hinausgeworfen, die
abgenagte Stelle kaschiert. Die Gäste kommen, essen und trinken bis tief in die Nacht.
Als die Frau den letzten Gast an der Haustür verabschiedet, sieht sie die Katze draußen
liegen: tot. Der Lachs war vergiftet, erkennt die Hausfrau und informiert in heller Panik
alle Gäste, sie sollten sich den Magen auspumpen lassen. Als sie sich um die tote Katze
kümmern will, die immer noch vor der Tür liegt, findet sie neben dem Tier einen Zettel:
"Tut mit leid!" steht drauf, "ich habe Ihre Katze überfahren, als sie
über die Straße gegangen ist."
Der Rattenzahn in der Pizza, die Spinne in der Yukkapalme oder das
Hundefutter im China-Restaurant: Hinter solchen Erzählungen verbirgt sich eine
tiefverwurzelte, halb unbewusste Angst vor Einflüssen aus fremden Ländern und Kulturen.
Paradebeispiel ist der "Rattenhund". 35 plus x Versionen gibt es von dieser
Geschichte! Inhalt: Jemand bringt aus dem Ausland einen kleinen zugelaufenen Hund mit. Der
bellt nicht, ist ganz lieb, frisst aber lebende Katzen. Tierarzt oder Zoodirektor stellen
dann fest: "Das Hündchen" ist eine Riesen-(Beutel-, Wüsten-)Ratte. Die
Geschichte eignet sich ideal zum Erzählen, weil sie den Bedürfnissen des Erzählers und
Zuhörers gleichermaßen entgegenkommt. Während der eine in weniger als einer Minute die
Fakten auf den Tisch legt, dichtet der andere nette Einzelheiten hinzu und hält seine
Zuhörer fünf- bis zehnmal so lange in Atem. Die Vielfalt der Versionen veranschaulicht
die Erzählkultur, die individuelle Ausschmückung offenbart Aufschlussreiches über den
Erzähler. Der Traumurlaub, die von allen ersehnte "schönste Zeit des Jahres" -
und doch kein ungetrübtes Glück, weil voller Gefahren. Das Gefährliche erschleicht sich
die Zuneigung durch Verstellen, um dann umso nachhaltiger den Menschen in Schrecken zu
setzen. |
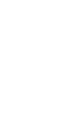
|